Publikationen des Instituts
Mit der „Schriftenreihe des Deutschen Instituts für Heimerziehungsforschung“
veröffentlicht unser Institut seit 2015 regelmäßig die Ergebnisse eigener wissenschaftlicher Forschungen.Im Zentrum der bisherigen Arbeit stand die Aufarbeitung der Geschichte der Sozialpädagogik in Deutschland des 20. Jahrhunderts.

Dreier-Horning, Anke:
Wie Anton S. Makarenko ein Klassiker der Pädagogik wurde
Zum Stand der Makarenkoforschung in Deutschland
Berlin 2022
Anton Semjonowitsch Makarenko (1888-1939) leitete in den 1920er/30er Jahren mehrere Kolonien für straffällige Kinder und Jugendliche in der Ukraine. Sein literarisches Hauptwerk Pädagogisches Poem" wurde in über 40 Sprachen übersetzt. Bis heute gilt er als Klassiker der Pädagogik - zu Recht? In der DDR und der BRD wurde Makarenko zum Gegenstand des Kalten Krieges, sogar mit unterschiedlichen Übersetzungen in Ost und West. Die einen erklärten ihn zum bürgerlichen Reformpädagogen, die anderen zum kommunistischen Pädagogen. Kritiker hingegen sahen in ihm einen Stalinisten.
Anke Dreier-Horning spürt die unterschiedlichsten Narrative und Mythen der Rezeption Makarenkos in Ost und West auf und konfrontiert diese mit den historischen Tatsachen. Ihre Analyse dekonstruiert bestehende und bisher als verlässlich angesehene Erzählformen, indem sie wirkungsmächtige Faktoren (z.B. die Erhebung Makarenkos in den Rang eines Klassikers) sichtbar macht und problematisiert.
Anke Dreier-Horning spürt die unterschiedlichsten Narrative und Mythen der Rezeption Makarenkos in Ost und West auf und konfrontiert diese mit den historischen Tatsachen. Ihre Analyse dekonstruiert bestehende und bisher als verlässlich angesehene Erzählformen, indem sie wirkungsmächtige Faktoren (z.B. die Erhebung Makarenkos in den Rang eines Klassikers) sichtbar macht und problematisiert.
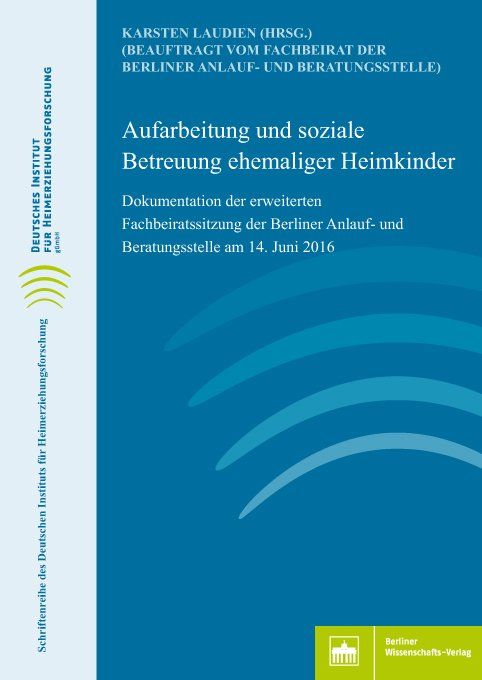
Laudien, Karsten (Hrsg.):
Aufarbeitung und soziale Betreuung ehemaliger Heimkinder
Dokumentation der erweiterten Fachbeiratssitzung der Berliner Anlauf- und Beratungsstelle am 14. Juni 2016Berlin, 2018.
Aufarbeitung der Heimerziehung der 40er bis 90er Jahre bedeutet nicht nur, ehemalige Heimkinder finanziell zu entschädigen (was durch die Fonds Heimerziehung bereits erfolgt), sondern auch die Spätfolgen zu lindern. Der Fachbeirat der Berliner Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder (ABeH) versucht daher, die sozialpädagogischen Bedürfnisse der Betroffenen zu artikulieren und die Erkenntnisse des Aufarbeitungsprozesses sowohl der Öffentlichkeit als auch den Betroffenen zugänglich zu machen – auch um derartiges Unrecht künftig zu verhindern.
Karsten Laudien, Manfred May und Stefan Trobisch-Lütge präsentieren die Ergebnisse der Überlegungen und stellen konkrete Projekte zum Wissenstransfer sowie zur Betreuung und Beratung ehemaliger Heimkinder vor. Ergänzt werden diese mit Ausschnitten aus Interviews mit Betroffenen, die eindrücklich die Bedeutsamkeit des Aufarbeitungsprozesses belegen. Gerade der Umgang mit Menschen, denen in der Vergangenheit schuldlos Unrecht zugefügt wurde, ist ein Gradmesser für die Möglichkeiten unserer Gesellschaft, Gerechtigkeit herzustellen und Anerkennung zu verteilen.
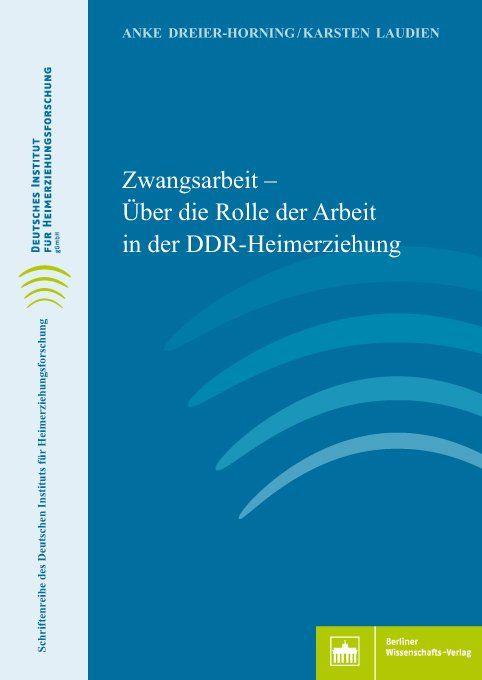
Laudien, Karsten; Dreier-Horning, Anke:
Zwangsarbeit -
Über die Rolle der Arbeit in der DDR-HeimerziehungBerlin, 2018.
Die DDR-Heimerziehung ist – trotz zahlreicher Veröffentlichungen in jüngster Zeit – ein noch immer kontrovers diskutiertes Feld. Zu wenig weiß man bisher über die konkreten Lebensbedingungen in den Einrichtungen der Jugendhilfe und zu widersprüchlich ist die nachträgliche Bewertung des Heimaufenthaltes seitens der Betroffenen.
Die Arbeitssituation von Kindern und Jugendlichen in DDR-Jugendhilfeeinrichtungen war Gegenstand einer von der Ostbeauftragten der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Studie, deren Ergebnisse hier präsentiert werden. Die Autoren werfen einen differenzierten Blick auf ein komplexes System, das von Arbeitserziehung, Strafarbeit, Berufsausbildung bis hin zu Arbeit unter Zwang reichte, und stellen die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen von Arbeitseinsätzen in der DDR-Heimerziehung dar. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen der Arbeitsformen auf die weitere Biografie der Betroffenen und deren heutiger Bewertung der Erlebnisse. Abschließend geht es um die Frage, ob Arbeitsbedingungen und -tätigkeiten in den Heimen der DDR eine
Form von „Zwangsarbeit“ darstellten.

Laudien, Karsten; Dreier-Horning, Anke:
Die Jugendhilfe im Berliner Stadtbezirk Lichtenberg (1945-1989)
Zwischen Anspruch und WirklichkeitBerlin, 2016.
Diese Studie ist durch einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg zur Aufarbeitung der Jugendhilfe im Stadtbezirk initiiert worden. Der Bezirk Lichtenberg in Berlin war bis Oktober 1949 Sitz der sowjetischen Militäradministration und bis 1989 Sitz des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR.
Die Autoren beschäftigen sich mit der Heimerziehung des Bezirkes von 1945 bis 1989. Dabei geht es nicht allein um die Kinderheime und deren Erziehungspraxis, sondern auch um die Tätigkeit der Jugendfürsorger und Jugendhelfer im Vorfeld der Heimeinweisungen. Es wird dabei anhand exemplarischer Fälle die Arbeitsweise der DDR-Jugendhilfe und deren pädagogische Grundhaltung nachvollzogen.

Laudien, Karsten;Dreier-Horning, Anke (Hrsg.):
Jugendhilfe und Heimerziehung im Sozialismus
Beiträge zur Aufarbeitung der Sozialpädagogik in der DDRBerlin, 2016.
Die Heimerziehung und Jugendhilfe der DDR beschäftigt erst seit Kurzem Öffentlichkeit, Politik und Medien. Das Wissen um das Schicksal tausender Betroffener, die Gewalt und Unrecht in den Einrichtungen der Jugendhilfe erfahren haben, führte zu einer ersten wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas. Dabei galt es, zunächst die Erziehungsvorstellungen und -methoden der DDR-Pädagogik zu erforschen und ihre Funktionsweise nachzuzeichnen.
Dieser Aufsatzband beschäftigt sich mit Sonderbereichen der Sozialpädagogik in der DDR, die bislang nicht im Fokus der Aufarbeitung standen und dennoch einen wichtigen Teil des gesamten Phänomens Jugendhilfe und Heimerziehung darstellen. Erstmals wurden u.a. die Säuglingsheime der DDR, die Medikamentenvergabe in den Heimen und die Ausbildung von Heimerziehern erforscht. Ein Aufsatz beschäftigt sich zudem mit dem Einfluss der Staatssicherheit auf die Jugendhilfe der DDR.
Das interdisziplinäre Forschungsprojekt, in dessen Rahmen dieser Aufsatzband entstand, vereinigte Wissenschaftler aus den Bereichen der Rechts-, Geschichts-, Politik- und Erziehungswissenschaft sowie der Soziologie und Philosophie. Ihre gemeinsame Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur historischen und gegenwärtigen sozialpädagogischen Forschung.